Gesellschaft, Kunden und Gesetzgeber stellen immer höhere Ansprüche an die Nachhaltigkeit von Unternehmen. Um diese zu erfüllen, können Firmen auf zahlreiche Förderprogramme zurückgreifen, um ihren Betrieb klimafreundlicher zu machen2.
Aber Vorsicht: die Umsetzung einer Investition von der Höhe der Zuschüsse abhängig zu machen, wäre wenig zielführend. Vielmehr sollten Unternehmer sich fragen, welches Ziel sie erreichen möchten.
Im aktuellen „KfW-Klimabarometer 2025“ antworteten mehr als 70 Prozent der befragten Unternehmen, dass sie vor allem die Energiekosten senken wollen. Weitere Treiber sind der Wunsch, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten sowie gesetzliche Vorgaben.
Auch Imageaufwertung, Wettbewerbsvorteile und der Zugang zu neuen Märkten gewinnen laut KfW zunehmend an Bedeutung – ganz besonders mit Blick auf die ESG-Ratings und die Berichtspflichten nach der CSRD.
Je konkreter die Ziele formuliert sind − zum Beispiel „den Stromverbrauch um 25 Prozent reduzieren“, oder „den CO2-Ausstoß um ein Drittel verringern“ –, desto passgenauer können Programme identifiziert werden.

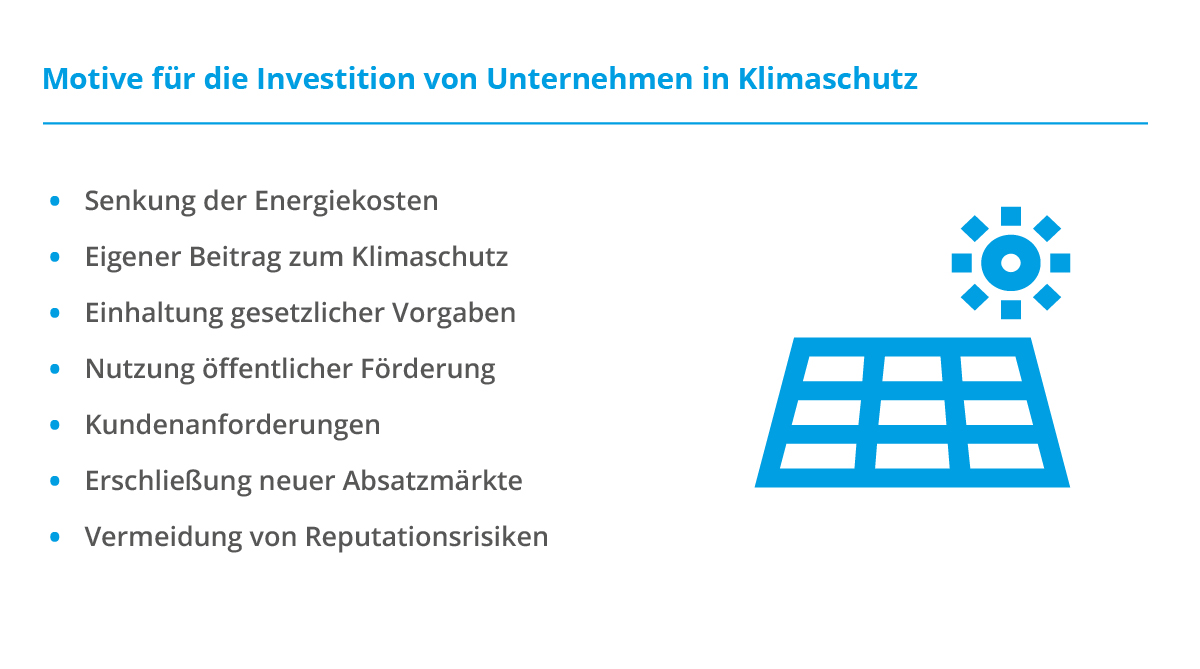
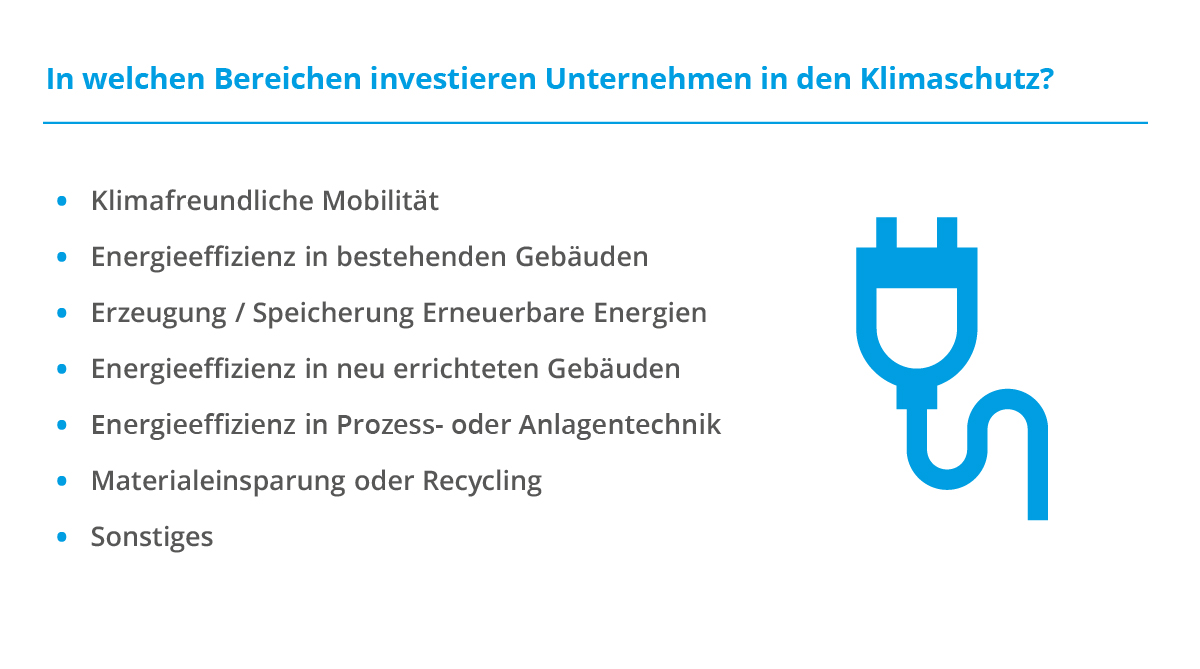
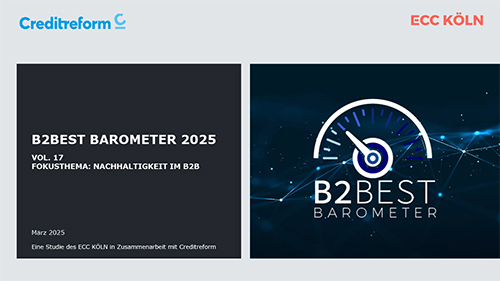

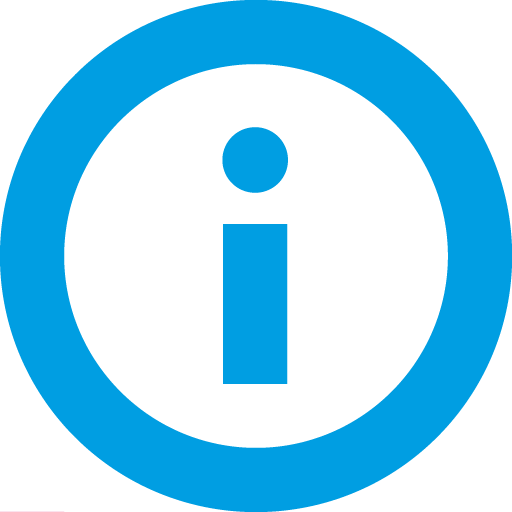



 Jetzt mit uns chatten!
Jetzt mit uns chatten!  Jetzt mit uns chatten!
Jetzt mit uns chatten! 