Bereit für den Blackout?
Stromausfälle werden wahrscheinlicher – wegen des extremen Wetters und der Transformation des Stromnetzes. Die gravierenden Folgen ließen sich jüngst in Spanien und Portugal beobachten. Worauf es im Ernstfall ankommt.
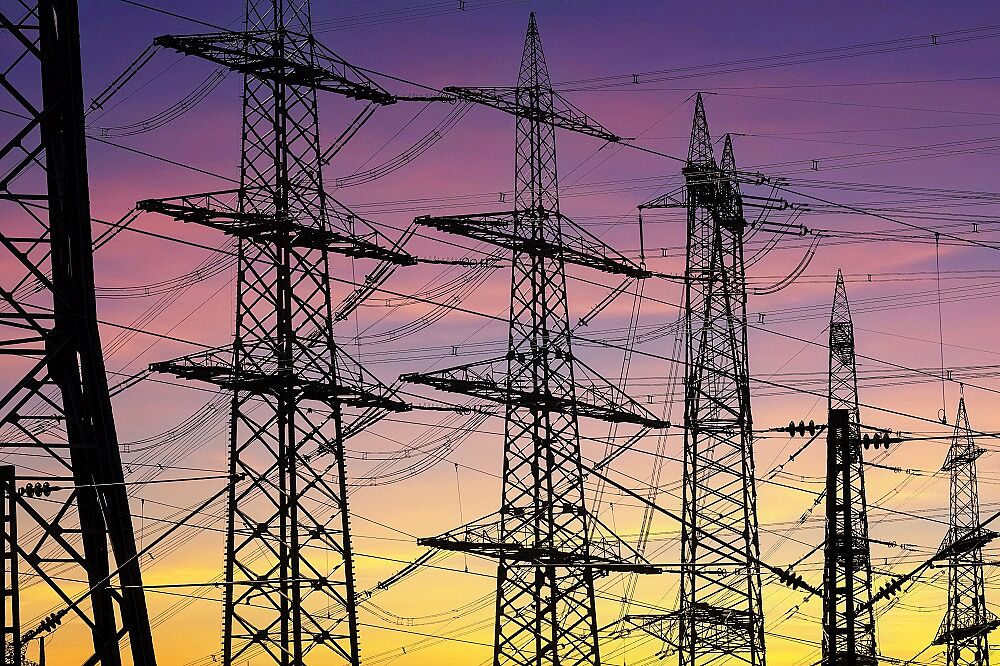
Ein Konferenzraum in Norddeutschland. Unter dem Fenster sind Lagerplätze und eine Fertigungshalle zu sehen. Noch läuft die Frühschicht. Am Horizont rotieren Windräder. Die Sonne scheint, der ist Strom günstig. Doch in diesem Moment fällt im nächstgelegenen Umspannwerk eine Steuerungseinheit aus – Blackout. Rund um den Konferenztisch tritt ein halbes Dutzend Personen sofort in Aktion. Sie haben sich nicht zufällig zu dieser Zeit am richtigen Ort versammelt. Der Stromausfall an diesem Dienstagvormittag war geplant und ist eine Simulation. „Krisen sind jedes Mal anders“, sagt der Geschäftsführer Ralf Marczoch von Mata Solutions, der Unternehmen in Krisenmanagement schult und sie auf den Ernstfall vorbereitet.
Der Bedarf ist groß. „Viele Unternehmen machen sich zunehmend Sorgen um ihre Stromversorgung“, sagt der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Dercks. „Selbst kurze Störungen machen den Betrieben zu schaffen. Sie können insbesondere in der Industrie zu großen Einschränkungen in den Produktionsprozessen führen.“ Bei fast einem Drittel der Industriebetriebe kommt es Dercks zufolge zu Stromunterbrechungen. „Ein besonders starker Anstieg ist bei Stromausfällen von unter drei Minuten zu verzeichnen. Der Anteil der hiervon betroffenen Betriebe ist innerhalb von drei Jahren von 10 auf 16 Prozent gestiegen.“ Laut der DIHK-Umfrage greifen immer mehr Unternehmen zur Selbsthilfe. Rund die Hälfte der Betriebe hat sich auf Stromausfälle vorbereitet oder plant dies zumindest. Zu den Vorkehrungen zählen Notstromaggregate oder Stromspeicher.
Unternehmen kümmern sich zwar verstärkt um diese Themen – werden aber ungern in der Presse mit einer offenen Flanke genannt. So auch das Unternehmen, in dessen Konferenzraum Marczoch und sein Team ihre Schulung abhalten. Der Experte für Krisenmanagement weiß bereits, womit die anwesenden Führungskräfte als Nächstes konfrontiert werden. Er und sein Team besuchen Betriebe in ganz Deutschland, um mit ihnen den Ernstfall zu proben. Marczoch betont: „Als Mathematiker fällt mir immer wieder auf, wie wenig wir Menschen tatsächlich vorhersagen können. Wir müssen daher reagieren lernen. Pläne reichen nicht, man muss üben.“
Wie das Unternehmen seine Mitarbeiter in der Logistik kontaktieren kann zum Beispiel. Die elektrischen Tore, hinter denen die Lkw sonst parken, funktionieren bei Stromausfall nicht. Wo sollen die Fahrer ihre Fracht abstellen? Das Satellitentelefon im Truck lässt Marczoch nicht als einfache Lösung durchgehen. Sein Beratungsunternehmen hat die Zuverlässigkeit der Technologie für den Kommunikationsbedarf eines Betriebs im Krisenmodus getestet. Das Ergebnis: Nur rund ein Drittel der Gespräche kommt durch. Verbindungsabrisse sind deutlich häufiger als im Mobilfunknetz – und das unter alltäglichen Bedingungen.
Laufen im Ernstfall tausende Telefonate über Satellit, sieht es voraussichtlich schlechter aus. Marczoch rät den Anwesenden daher, schon im Vorfeld sichere Orte außerhalb des Werks festzulegen, an denen die Lkw abgestellt werden sollen, wenn das Tor zu bleibt.
Was das deutsche Stromnetz vom spanischen unterscheidet
Laut Statistik treten etwa 99 Prozent aller Stromausfälle im Niederspannungsnetz auf. So auch der, den Marczoch an diesem Tag simuliert. Der großflächige Stromausfall auf der Iberischen Halbinsel am 28. April war dagegen ein Infarkt auf Übertragungsebene. Verhindern soll das eigentlich das sogenannte „N-1-Kriterium.“ Dieser Grundsatz in der Netzplanung soll Blackouts verhindern – selbst dann, wenn eine wichtige Komponente ausfällt. Wenn, wie jüngst in Spanien, innerhalb kürzester Zeit jedoch gleich zwei oder drei kritische Komponenten im Netz zusammenbrechen, setzt sich der Ausfall wie ein Lauffeuer fort. Bis ihm Notabschaltungen Einhalt gebieten.
Für Haushalte und Betriebe im betroffenen Gebiet ist der Strom dann schon weg. In Teilen Spaniens dauerte es im April fast 24 Stunden, bis das Netz vollständig wieder lief. Abhängig von Branche, Unternehmensgröße und möglichen Folgeschäden kann ein solcher Ausfall leicht mit bis zu siebenstelligen Kosten zu Buche schlagen. Extreme Wetterlagen wie Starkwind, Überschwemmungen oder Hitzewellen sind weltweit die Hauptursache für Stromausfälle. Der Klimawandel macht diese Ereignisse noch häufiger und intensiver. Damit bedroht er direkt die elektrische Infrastruktur.
Gerade deshalb bleibt der rasante Ausbau erneuerbarer Energien für die Dekarbonisierung unerlässlich. Er bringt aber zugleich neue Herausforderungen für die Stromnetze, die ursprünglich für die Verteilung aus großen zentralen Kraftwerken ausgelegt sind. Die steigende Zahl kleiner Einspeiser macht sie komplexer; zugleich fallen mit den Kohle- und Kernkraftwerken nach und nach bisherige Stabilitätsanker weg. Ihre großen, schweren Turbinenräder wirkten durch die Massenträgheit wie Stoßdämpfer im System. Parallel zu ihrem Wegfall steigt der Strombedarf durch den Umstieg auf Elektroautos, Wärmepumpen und andere grüne Technologien.
Wie viele andere Industrienationen kämpft Deutschland bei der Energiewende mit einer veralteten Infrastruktur. Zwischen Deutschland und seinen Nachbarländern bestehen mehr belastbare Verbindungen als zwischen Spanien und dem Rest Europas. Ein umfangreicher Stromausfall wie in Spanien und Portugal ist in Deutschland nach Angaben der Bundesnetzagentur grundsätzlich nicht zu befürchten. Klaus Müller, Chef der Aufsichtsbehörde, bestätigte in der „ARD-Tagesschau“, dass ein derartiger Vorfall in Deutschland bislang nicht aufgetreten sei. „Wir verfügen über mehrere Sicherungssysteme im deutschen Stromnetz“, so Müller. „Und für den Ernstfall stehen sogenannte schwarzstartfähige Kraftwerke bereit, die das Netz eigenständig wieder hochfahren könnten. Deutschland ist also gut gerüstet.“ Ganz so unkritische sehen das andere in der Branche nicht. Kritiker halten lokale Ausfälle trotz entsprechender Vorsichtsmaßnahmen für möglich – ebenso eine Überspannung wie jene, die die Ereignisse vom April in Spanien in Gang gesetzt hatte.
Risikofaktor Cybersicherheit
Zur steigenden Komplexität des Netzes, Wartungs- und Ausbaustau sowie der Gefahr von Naturkatastrophen kommen zudem Cyberrisiken. Zwischen Planbarkeit für die Netzbetreiber und Cybersicherheit gibt es dabei einen Zielkonflikt. Was sich aus der Ferne digital steuern lässt, kann auch einem Hackerangriff zum Opfer fallen. In einem Positionspapier stuft das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, die Bedrohungslage im Infrastrukturbereich bereits als „kritisch“ ein. Besonders der Energiesektor stünde im Fokus staatlich unterstützter Hackergruppen, Cyberkrimineller und politischer Extremisten, schreibt die Behörde. „Es gibt keinen Notfallplan, der jedes Szenario abdeckt“, warnt Marczoch und rechnet vor: „Passiert der Ausfall im Sommer oder im Winter? Während der Arbeitszeit oder außerhalb? Dauert er Stunden oder Tage? Selbst wenn man nur wenige solcher Unterscheidungen macht, muss man schnell mit vier, acht oder 16 Varianten planen.“
Die einzuleitenden Schritte sehen für jedes Unternehmen ebenfalls unterschiedlich aus. Sie hängen zum Beispiel davon ab, wie bestimmte Anlagen heruntergefahren werden müssen und ob der Betrieb Publikumsverkehr hat. Und davon, welche digitale Kommunikationskanäle zu anderen Standorten, Kunden, oder Dienstleistern aufrechterhalten werden müssen. Je nach Branche kommen außerdem rechtliche Pflichten ins Spiel. So kann ein Stromausfall zum meldepflichtigen Vorfall gemäß Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) werden, wenn er zum unwiederbringlichen Verlust personenbezogener Daten führt.
Handlungsspielräume schaffen
In jedem Fall beginnt die Vorbereitung mit einer Einschätzung der Risiken und ihrer Folgen. Neben Blackouts gehören auch Cyberattacken oder Extremwetterereignisse zu den Bedrohungen, die Betriebe adressieren sollten. Marczoch rät: „Unternehmen müssen schon im Vorfeld Handlungsspielräume für verschiedene Szenarien schaffen. Ich würde für Arbeitsplätze zum Beispiel nur noch Laptops anschaffen. Wenn der Strom ausfällt, laufen die erst mal einfach weiter.“ Auch vermeintlich Einfaches kann bei einem Blackout zum unerwarteten Hindernis werden. „Wie kommen wir ins Gebäude, wenn die elektronische Schließanlage ausfällt?“ fragt Marczoch bei der Krisensimulation in die Runde.
Die Gebäude dieses Unternehmens haben zusätzliche Eingänge, die sich, ganz analog, mit einem Schlüssel öffnen lassen. Doch wie lässt sich sicherstellen, dass die Person mit dem Schlüssel auch anwesend ist? Im Fall der Fälle muss so etwas schnell gehen. Daher sollten Unternehmen bereits im Vorfeld ein Notfallteam mit klarer Rollenverteilung festlegen und Eskalationsstufen definieren. Laut Marczoch sind kleine Krisenteams oft besser als große. Mittelständische Unternehmen haben gegenüber Konzernen zudem den Vorteil, dass sich viele wichtige Akteure bereits kennen. Als Königsweg betont der Berater auch für sie das wiederholte Üben, zum Beispiel alle zwei Jahre. Eine regelmäßig durchgeführte Inventur zahlt sich ebenfalls aus: Sind die Erste-Hilfe-Kästen befüllt, liegen Batterien für die Taschenlampe bereit? Sowohl seitens der Stromversorger und Netzbetreiber als auch der Politik laufen viele Maßnahmen, die Blackouts verhindern sollen. Stromautobahnen, Reservekraftwerke oder Batteriespeicher können ihren Teil dazu beitragen. Trotzdem sind sich Experten in einem Punkt einig: Die Frage ist nicht, ob es zum nächsten Blackout kommt, sondern wann.
Im Konferenzraum ist die Übung mittlerweile abgeschlossen. In der Fertigung nebenan läuft die Produktion weiter. Dort ist dieses Mal nichts geschehen – auch ein Stillstand dort ließe sich jedoch proben. „Egal, welches Szenario wir durchspielen, es wird auf jeden Fall anders kommen. Entscheidend ist aber, dass durch regelmäßiges Üben bei einem echten Blackout alle viel schneller wissen, was konkret zu tun ist“, sagt Marczoch zum Abschluss und klappt seinen Computer – natürlich einen Laptop – zu.
Welche Folgen hat ein Stromausfall?
Ein Stromausfall wirkt sich auf viele Bereiche des täglichen Lebens aus, die auch Unternehmen betreffen – zum Beispiel auf Verkehr, Telekommunikation und verschiedenste Versorgungssysteme. Fällt der Strom für längere Zeit aus, wird es schwer, den Betrieb wie gewohnt aufrechtzuerhalten. Einschränkungen oder sogar Ausfälle drohen vor allem bei:
- Festnetz, Mobilfunk, Internet und Datenverbindungen
- akku- und batteriebetriebenen Geräten wie Laptops und Handys
- elektronischen Alarm-, Schließ- und Zutrittssystemen
- Kontroll-, Sicherheits- und Steuersystemen
- Bürogeräten, Rechenzentren und Serveranlagen
- Treibstoffversorgung und Transportlogistik
- beim Banken- und Finanzsystem
- Wasserver- und Abwasserentsorgung
- Beleuchtung/Notbeleuchtung
- Lüftungs- und Klimaanlagen sowie Kühlungen, Prozessleitsystemen und Brandmeldeanlagen
- Heizungsanlagen sowie Wasserpumpen im Heizkreislauf
- Personenaufzügen
Quelle: IHK Elbe-Weser
Quelle: Magazin "Creditreform"
Text: Calvin Major
Bildnachweis: Getty Images


