Wirtschaftsauskunft: Geschäftspartner im Blick
Kennen Sie Ihre Geschäftspartner durch und durch? Eine Wirtschaftsauskunft sorgt für die nötige Transparenz und sichere Geschäfte. Doch wer darf sie einholen und was steht in einer Auskunft?
Zum ArtikelFirmen kommen an ESG nicht mehr vorbei. Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung werden messbar und zum zentralen Faktor im Wettbewerb um Kapital, Kunden und Talente.
Nachhaltigkeit gehört längst zu den großen gesellschaftlichen Themen der 2020er Jahre – und wird auch für Unternehmer zum Pflichtprogramm. Vom Einzelhändler bis zum Automobilzulieferer, vom Handwerksbetrieb bis zum IT-Dienstleister: Sie alle stehen vor der Herausforderung, nachhaltiger zu wirtschaften.
Laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung aus dem Jahr 2024 gaben 60 Prozent der befragten Unternehmen an, dass Nachhaltigkeit ein zentraler Treiber für die Veränderung ihrer Geschäftsmodelle ist – je tiefgreifender der Wandel, desto größer wird die Bedeutung nachhaltigen Handelns eingeschätzt.1 Besonders mittelständische Unternehmen sehen Nachhaltigkeit als Chance für ihre Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit. So lautet das Fazit einer Untersuchung des Haufe-Verlags.2 Viele Betriebe empfinden die regulatorischen Vorgaben zwar als bürokratische Herausforderung, haben nach der Studie jedoch praktikable Wege gefunden, damit umzugehen.
Mit dem Green Deal verfolgt die EU-Kommission das Ziel, Europa bis 2050 klimaneutral zu machen. In Deutschland gilt seit 2023 das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG); auf europäischer Ebene wird ab 2027 die Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) – besser bekannt als EU-Lieferkettengesetz – wirksam. Beide Regelwerke verpflichten Unternehmen dazu, soziale und ökologische Risiken in ihren Lieferketten zu identifizieren und zu minimieren.
Auch bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung gibt es neue Entwicklungen: Am 10. Juli 2025 hat das Bundesjustizministerium einen neuen Referentenentwurf zur Umsetzung der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) vorgelegt. Der Entwurf berücksichtigt die „Stop-the-Clock“-Richtlinie der EU, wonach für Unternehmen der zweiten und dritten Welle die Berichtspflichten um zwei Jahre verschoben werden3. Zudem sollen Unternehmen der ersten Welle mit 501 bis 1.000 Mitarbeitern für die Geschäftsjahre 2025 und 2026 aus der Berichtspflicht genommen werden. Ziel ist es, die Berichtspflicht praxistauglicher zu gestalten und mittelständische Betriebe nicht unnötig zu belasten.
Nachhaltigkeit sichtbar und greifbar machen – das ist die Herausforderung für viele Unternehmen. Als anerkannter Standard haben sich dabei die ESG-Kriterien etabliert. Und dafür stehen die drei Buchstaben im Detail:
E wie Environment: Gemeint sind alle ökologischen Auswirkungen, die unternehmerisches Handeln auf Umwelt und Klima hat – etwa Emissionen, Energie- und Wasserverbrauch, Biodiversität.
S wie Social: Hier geht es um soziale Verantwortung, etwa durch Arbeits- und Gesundheitsschutz, Diversität, Menschenrechte in der Lieferkette und gesellschaftliches Engagement.
G wie Governance: Steht für eine verantwortungsvolle Unternehmensführung, die sich durch Transparenz, Rechtskonformität und wirksame Steuerungs- und Kontrollsysteme auszeichnet.
Die Finanzwirtschaft ist zum Treiber nachhaltiger Unternehmensführung geworden. Ohne ESG-Transparenz – also belastbare Angaben zu Umwelt, Sozialem und zur Unternehmensführung – läuft bei der Kreditvergabe kaum noch etwas. Banken und institutionelle Investoren stützen ihre Entscheidungen zunehmend auf ESG-Ratings und Nachhaltigkeitskennzahlen.
Laut einer aktuellen Analyse der Förderbank KfW sind in Deutschland bis 2045 Investitionen in Höhe von rund fünf Billionen Euro nötig, um die Klimaziele zu erreichen.4 Diese Summe soll zu großen Teilen von Banken, Unternehmen und privaten Kapitalgebern gestemmt werden.
Zugleich zeigt sich: Die ESG-Bilanz eines Unternehmens wirkt sich immer stärker auf die Finanzierungsmöglichkeiten aus. Für die Kreditvergabe verlangen Geldinstitute zunehmend detaillierte ESG-Informationen – etwa zu Klimarisiken im Geschäftsmodell. Zudem verschärfen sich die regulatorischen Anforderungen: Unternehmen müssen gegenüber Aufsichtsbehörden nachweisen, dass sie Nachhaltigkeitsrisiken „angemessen und explizit“ in ihre Risikosteuerung einbeziehen – und zwar mit belastbaren ESG-Daten.
Wer glaubhaft zeigen kann, dass er Nachhaltigkeit nicht nur als Etikett, sondern als Teil seines Geschäftsmodells begreift, verbessert seine Chancen auf Fremdkapital deutlich.
Seit Januar 2025 schreibt die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) vor, dass ESG-Faktoren explizit in die Kreditrisikobewertung integriert werden müssen. Betroffen sind vor allem klimabezogene Risiken – etwa durch CO₂-intensive Prozesse oder extreme Wetterereignisse –, aber auch soziale und Governance-bezogene Aspekte. Banken müssen entsprechende Risiken identifizieren, bewerten und dokumentieren und erwarten dasselbe zunehmend von ihren Unternehmenskunden.
Gleichzeitig weitet sich der regulatorische Rahmen aus: Mit der EU-Taxonomie und der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) hat die EU zwei zentrale Säulen geschaffen, die nachhaltiges Wirtschaften messbar und vergleichbar machen sollen.

Whitepaper zum Thema herunterladen
Praxisratgeber ESG
Erfahren Sie in unserem Whitepaper,
Mit der Taxonomie-Verordnung definiert die EU einheitliche Maßstäbe für ökologisch nachhaltiges Wirtschaften. Ziel ist es, unternehmerische Tätigkeiten objektiv bewerten zu können: Leisten sie einen „grünen“ Beitrag – oder nicht? Diese Systematik soll Investoren, Banken und anderen Marktteilnehmern helfen, gezielt Kapital in nachhaltige Geschäftsmodelle zu lenken.
Anhand dieser Bewertung sollen Investoren oder Geldgeber einschätzen können, ob ein Unternehmen nachhaltig arbeitet. Unterteilt ist die Taxonomie bisher in folgende sechs Umweltziele:
Seit Januar 2024 gelten technische Bewertungskriterien für alle sechs Ziele – die EU-Taxonomie ist damit in vollem Umfang anwendbar. Unternehmen, die als nachhaltig eingestuft werden möchten, müssen künftig nachweisen, dass ihre Aktivitäten mindestens einem dieser Umweltziele dienen, ohne dabei die übrigen Ziele erheblich zu beeinträchtigen („Do No Significant Harm“-Prinzip). Außerdem sind soziale Mindestanforderungen – insbesondere die Achtung der Menschenrechte – verbindlich einzuhalten.
Im März 2025 hat die EU-Kommission die Taxonomie nochmals erweitert und mehr als 40 zusätzliche Wirtschaftstätigkeiten aufgenommen – darunter Rechenzentren, Biokunststoffe, CO₂-Abscheidung (Carbon Capture) sowie Aktivitäten im Bereich der Batterieproduktion und Stromspeicherung. Damit rückt der technologische Sektor stärker in den Fokus der Nachhaltigkeitsklassifizierung.
Die EU-Taxonomie gilt noch nicht für alle Unternehmen. Zunächst richtete sich die Verordnung ausschließlich an große börsennotierte Unternehmen, Banken und Versicherungen, die als sogenannte Public Interest Entities (PIEs) unter der früheren Non-Financial Reporting Directive (NFRD) zusammengefast wurden. Diese Unternehmen mussten offenlegen, ob – und in welchem Umfang – ihre wirtschaftlichen Aktivitäten mit den ökologischen Zielen der Taxonomie übereinstimmen.
Mit dem Inkrafttreten der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) wurde der Kreis der berichtspflichtigen Unternehmen deutlich ausgeweitet. Aktuell gilt die Taxonomie für alle Unternehmen, die unter die neue Richtlinie fallen – als da wären
Ab dem Geschäftsjahr 2026 wird die Berichtspflicht weiter ausgeweitet – dann erfasst sie auch große Unternehmen ohne Börsennotierung (Nicht-PIEs), also mittelständische und nicht-börsennotierte Betriebe ohne besondere öffentliche Relevanz. Für sie gilt die EU-Taxonomie in Verbindung mit der CSRD ebenfalls – inklusive der Pflicht zur Offenlegung taxonomierelevanter Kennzahlen.

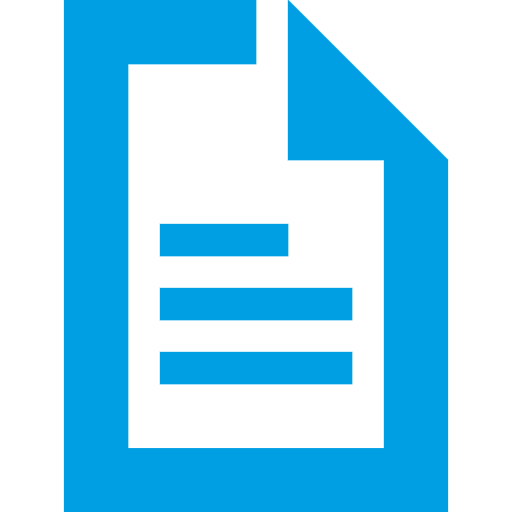
Mit der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verpflichtet die EU Unternehmen zu einem neuen Transparenz-Standard: Nachhaltigkeit wird zur Berichtspflicht – strukturiert, digital, verbindlich. Ziel ist es, Investoren, Behörden und der Öffentlichkeit ein verlässliches Bild davon zu geben, wie nachhaltig ein Unternehmen tatsächlich wirtschaftet. Die CSRD ersetzt die bisherige CSR-Richtlinie und bringt deutlich verschärfte Anforderungen mit sich.
Betroffen sind künftig alle Betriebe, die an einem EU-regulierten Markt notiert sind – mit Ausnahme von Kleinstunternehmen. Darüber hinaus gilt die CSRD für nicht-börsennotierte Unternehmen, wenn sie mindestens zwei der folgenden drei Kriterien erfüllen:
Insgesamt sollen laut EU-Kommission künftig rund 50.000 Unternehmen in Europa unter die CSRD fallen – darunter etwa 15.000 Unternehmen in Deutschland.
Im Zentrum der neuen Berichterstattung steht das Prinzip der doppelten Wesentlichkeit (Double Materiality): Unternehmen müssen sowohl angeben, welche Auswirkungen Nachhaltigkeitsfaktoren auf ihr Geschäft haben – als auch, wie sich ihr eigenes Handeln auf Umwelt und Gesellschaft auswirkt. Die CSRD verlangt in den Berichten Informationen unter anderem Informationen
Mit der CSRD entfällt die Möglichkeit, nichtfinanzielle Informationen in separaten Berichten offenzulegen. Zukünftig sollen Nachhaltigkeitsinformationen ausschließlich im Lagebericht veröffentlicht werden.
Die EU-Kommission rechnet damit, dass die ESG-Berichterstattung langfristig zur unternehmerischen Selbstverständlichkeit wird – auch über gesetzliche Pflichten hinaus. Nachhaltigkeit, so das Signal aus Brüssel, gehört zum Standard guter Unternehmensführung. Doch vor allem der Mittelstand tut sich noch schwer mit systematischer Datenerhebung und Kommunikation. Die EU-Kommission empfiehlt daher insbesondere kleineren Unternehmen, sich frühzeitig an etablierten ESG-Rahmenwerken wie den European Sustainability Reporting Standards (ESRS) zu orientieren – auch dann, wenn (noch) keine formale Berichtspflicht besteht. Ziel sei es, Reporting-Kompetenz frühzeitig aufzubauen und langfristig Investoren- sowie Kundenanforderungen erfüllen zu können.
Ohne einen einheitlichen Standard ist der Vergleich von Nachhaltigkeitsdaten verschiedener Unternehmen aber kaum möglich. Verschiedene Organisationen und Institutionen arbeiten deshalb seit Jahren daran, verlässliche Rahmenwerke für die ESG-Berichterstattung zu schaffen.
Durch die Gesetzgebung, die Anforderungen von Banken an Kreditnehmer sowie von Unternehmen an Geschäftspartner entwickeln sich Nachhaltigkeitsdaten zu einem neuen Bereich der Wirtschaftsinformation. Als führende Auskunftei in Europa wird Creditreform diesen Prozess mit validen Daten begleiten. „Unser Ziel ist es, zu jedem wirtschaftsaktiven Unternehmen in Deutschland eine belastbare Aussage zum Thema Nachhaltigkeit treffen zu können“, sagt Dr. Michael Munsch, Vorstand der Creditreform Rating AG. Mit seiner großen Erfahrung im Bereich der Bonitätsanalyse und Auskunft besitzt Creditreform die Technologien und das Know-how dazu.

Die Beschäftigung mit der eigenen Nachhaltigkeit ist in Zukunft nicht mehr wegzudenken. Unternehmen müssen Ihre Nachhaltigkeitsmaßnahmen verbessern, die ESG-Risiken ihrer Geschäftspartner beurteilen, regulatorische Maßnahmen erfüllen und nicht zuletzt auch das eigene nachhaltige Handeln transparent machen. Sie möchten sich Ihren ESG-Anforderungen stellen und sich dabei unterstützen lassen? Die Creditreform ESG-Services bieten Ihnen ein Rundum-Paket zum Thema ESG & Nachhaltigkeit.
Häufig gestellte Fragen und Antworten zum Thema
Unsere Texte dienen dem unverbindlichen Informationszweck und ersetzen keine spezifische Rechts- oder Fachberatung. Für die angebotenen Informationen geben wir keine Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit.
Wirtschaftsauskunft: Geschäftspartner im Blick
Kennen Sie Ihre Geschäftspartner durch und durch? Eine Wirtschaftsauskunft sorgt für die nötige Transparenz und sichere Geschäfte. Doch wer darf sie einholen und was steht in einer Auskunft?
Zum ArtikelESG: Nachhaltigkeit als Visitenkarte
Nachhaltigkeit wird vom "nice to know" zum absoluten Muss. Kunden, Banken und Geschäftspartner verlangen zunehmend Transparenz darüber, wer bei E, S und G schon gut aufgestellt ist und wer noch Nachholbedarf hat.
Zum Podcast7 Top-Strategien fürs Kreditgespräch
Sie brauchen einen Kredit? Wer gut vorbereitet ist, erhöht seine Chancen bei der Bank. Auf welche erfolgversprechenden Strategien Sie beim Kreditgespräch setzen sollten, damit die Finanzierung klappt.
Zum Artikel| Montag bis Freitag: | 08:00 - 16:30 |
 Jetzt mit uns chatten!
Jetzt mit uns chatten! Die Zuständigkeit unserer Experten richtet sich immer nach dem Geschäftssitz Ihres Unternehmens. Bei Fragen zur Mitgliedschaft oder zu unseren Produkten und Lösungen steht Ihnen Creditreform vor Ort zur Seite. Mit der Eingabe Ihrer fünfstelligen Postleitzahl finden Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner.

Sie werden jetzt zu Ihrer Geschäftsstelle weitergeleitet.

Sie werden jetzt zurück zur Übersichtsseite weitergeleitet.